Folge 1: KI-Tools im Schulalltag
Kai Wörner über den Einsatz von KI im Unterricht und neue Bewertungsmethoden
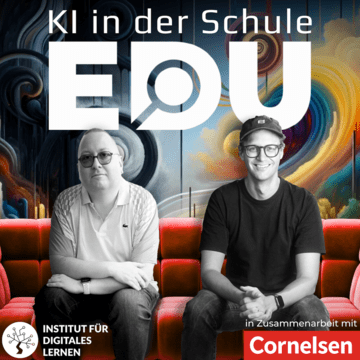
Wie verändert KI den Schulalltag? Kai Wörner, Realschullehrer am Europakanal in Erlangen und digitaler Pionier, gibt Einblicke in seine Erfahrungen. In dieser Folge erzählt er Podcast-Host Benjamin Heinz, wie er KI-Tools zur Unterrichtsvorbereitung nutzt, Musterlösungen erstellt und alternative Leistungsnachweise gestaltet. Wörner diskutiert auch, wie sich Aufgabenstellungen und Bewertungssysteme durch KI verändern und warum der Lehrberuf dadurch attraktiver wird. Er betont die Wichtigkeit eines proaktiven und kritischen Umgangs mit KI und gibt praktische Tipps für deren Integration in den Unterricht.
Folge 2: Zwischen Hype und Hoffnung
Silke Müller über die Realität von KI im Schulalltag und notwendige Systemveränderungen

Welche Auswirkungen hat KI auf das deutsche Schulsystem? Silke Müller, Schulleiterin der Waldschule Hatten und SPIEGEL-Bestsellerautorin, gibt tiefe Einblicke in die Herausforderungen und Chancen. Im Gespräch mit Podcast-Host Dr. Florian Sochatzy beschreibt sie das aktuelle Schulsystem als "Ruinenverwaltung" und erklärt, warum KI jetzt ein potenzieller Gamechanger sein könnte.
Müller diskutiert die Überholung klassischer Hausaufgaben im KI-Zeitalter und wie KI Lehrkräfte von Bürokratie entlasten kann. Sie plädiert für eine Neuausrichtung des föderalen Bildungssystems im Kontext von KI und betont die Notwendigkeit, trotz des technologischen Fortschritts den Menschen im Mittelpunkt zu behalten. Müller gibt praktische Einblicke in den Schulalltag mit KI und regt zu einem reflektierten Umgang mit den neuen Tools an.
Folge 3: KI in Medien, Bildung und Kreativität
Gregor Schmalzried über die Veränderung von Lernen, Schreiben und Kommunizieren durch KI

Wie verändert KI unsere Art zu lernen, zu schreiben und zu kommunizieren? Gregor Schmalzried, Host des ARD-KI-Podcasts, Autor und Techjournalist, teilt seine Erkenntnisse und Erfahrungen. Im Gespräch mit Podcast-Host Benjamin Heinz erklärt Schmalzried, wie KI als individueller Lernbegleiter fungieren kann und diskutiert die Herausforderungen bei der Bewertung KI-generierter Inhalte im Bildungskontext.
Schmalzried beleuchtet auch die Rolle von KI im kreativen Prozess, insbesondere beim Schreiben und Storytelling. Er reflektiert über die Zukunft des Autorberufs im KI-Zeitalter und die Frage, was Texte "menschlich" macht.
Darüber hinaus gibt er praktische Tipps zum Umgang mit KI-Tools, wie etwa die Arbeit mit großen Textmengen in Chatbots.
Schmalzried regt zu einem differenzierten Blick auf KI an, jenseits von Hysterie und übertriebener Euphorie, und betont die Bedeutung eines kritischen, aber offenen Umgangs mit der Technologie in Bildung und Kreativbranche.
Folge 4: KI im Fremdsprachenunterricht
Marje Stock über digitale Werkzeuge und kreatives Sprachenlernen mit KI

Wie revolutioniert KI den Fremdsprachenunterricht? Marje Zschiesche-Stock, renommierte DaF-Expertin und Innovatorin im Bereich KI für Sprachunterricht, teilt ihre Erkenntnisse und Erfahrungen. Im Gespräch mit Podcast-Host Benjamin Heinz erläutert Zschiesche-Stock, wie KI-Tools den Sprachunterricht bereichern und personalisiertes Lernen auf ein neues Level heben können.
Zschiesche-Stock gibt konkrete Einblicke in die praktische Anwendung von KI im DaF-Unterricht, von KI-generierten Bildpaaren für kreative Übungen bis hin zu personalisierten Lernszenarien. Sie diskutiert, wie sich die Rolle der Lehrkräfte im KI-Zeitalter verändert und welche neuen Chancen sich dadurch eröffnen. Dabei betont sie die Wichtigkeit, den menschlichen Faktor im Sprachenlernen nicht zu vernachlässigen.
Darüber hinaus beleuchtet Zschiesche-Stock die Herausforderungen beim Einsatz von KI, insbesondere im Hinblick auf kritisches Denken und den Umgang mit KI-generierten Inhalten. Sie gibt einen Ausblick auf die Zukunft des Fremdsprachenunterrichts und teilt praktische Tipps für Lehrkräfte, die KI in ihren Unterricht integrieren möchten.
Marje Zschiesche-Stock regt zu einem reflektierten und kreativen Umgang mit KI im Sprachunterricht an und zeigt auf, wie diese Technologie das Sprachenlernen effizienter, motivierender und individueller gestalten kann, ohne dabei die Bedeutung authentischer menschlicher Interaktion aus den Augen zu verlieren.
Folge 5: KI an Universitäten und Schulen
Prof. Dr. Niels Pinkwart über lästige Routineaufgaben, virtuelle Tutoren und die Zukunft der Universität

Wie verändert KI die Bildungslandschaft von der Schule bis zur Universität? Prof. Dr. Niels Pinkwart, KI-Experte und Vizepräsident der Humboldt-Universität zu Berlin, teilt seine Erkenntnisse und Visionen. Im Gespräch mit Podcast-Host Dr. Florian Sochatzy erläutert Pinkwart, wie KI Routineaufgaben reduzieren und mehr Raum für den Kern von Forschung und Lehre schaffen kann.
Pinkwart gibt Einblicke in konkrete KI-Anwendungen an der HU Berlin, wie etwa eigene Sprachmodelle für Studierende, und diskutiert die Möglichkeit virtueller Tutoren. Er beleuchtet die Herausforderungen bei der Integration von KI in Prüfungen und Lehre, ohne dabei den menschlichen Aspekt zu vernachlässigen. Besonders spannend ist sein Ausblick auf KI in der frühkindlichen Bildung, die er als wichtiges Forschungsthema der Zukunft sieht.
Darüber hinaus reflektiert Pinkwart die Veränderungen, die KI für Lehrende und Lernende mit sich bringt und gibt einen Ausblick auf die Universität der Zukunft. Er betont die Notwendigkeit eines kritischen und reflektierten Umgangs mit KI, sieht aber auch das enorme Potenzial, das diese Technologie für die Bildung birgt.
Prof. Dr. Niels Pinkwart regt zu einer differenzierten Betrachtung von KI in der Bildung an und zeigt auf, wie diese Technologie das Lernen und Lehren auf allen Ebenen des Bildungssystems verändern kann, ohne dabei die Bedeutung menschlicher Interaktion und kritischen Denkens aus den Augen zu verlieren.
Folge 6: Zeitgewinn durch KI? Die KI-Toolbox für den Schulalltag
Sandra Hestermann über cornelsen.ai und die Entlastung im Schulalltag

Wie kann KI den zunehmend heterogenen Klassenzimmern gerecht werden? Sandra Hestermann, Business Lead cornelsen.ai bei Cornelsen, gibt Einblicke in die KI-Toolbox von Cornelsen. Im Gespräch mit Podcast-Host Dr. Florian Sochatzy erläutert Hestermann, wie KI-Tools Lehrkräfte dabei unterstützen können, der steigenden Nachfrage nach Differenzierung im Unterricht gerecht zu werden.
„Die zunehmende Heterogenität in den Klassen ist etwas, wo mir Lehrer sagen: Ich brauche nicht zwei Differenzierungsstufen, sondern fünf!“
Sie stellt die verschiedenen Komponenten der cornelsen.ai Toolbox vor, die von der Unterrichtsplanung bis zur Korrektur reichen. Besonders hebt sie den KI-Material-Designer hervor, mit dem sich differenzierte Lehr- und Lernmaterialien wie lebensweltbezogene Gesprächsanlässe, Lesetexte oder Aufgaben auf verschiedenen Niveaustufen erstellen lassen.
Auch zur Zukunft des Schulbuchs äußert sich Hestermann: „Das Schulbuch bleibt wichtig, als verlässliches GPS. Was sich ändert, sind die neuen Möglichkeiten, es mit KI zu erweitern.“ Sie erklärt, wie KI traditionelle Lehrbücher ergänzen und flexibler machen kann.
Darüber hinaus beleuchtet Hestermann das Potenzial von KI für mehr Bildungsgerechtigkeit:
„KI wird ein Game Changer in Sachen Bildungsgerechtigkeit sein. Endlich haben wir die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler individuell nach ihren Potenzialen zu fördern und zu fordern.“
Sie erläutert, wie KI-Tools als Organisationsassistenten fungieren können, indem sie beispielsweise To-do-Listen erstellen oder die Kommunikation mit Eltern unterstützen.
Sandra Hestermann regt zu einem reflektierten Umgang mit KI in der Bildung an und zeigt auf, wie diese Technologie den Lehreralltag effizienter gestalten und gleichzeitig personalisiertes Lernen ermöglichen kann, ohne den menschlichen Aspekt des Lehrens zu vernachlässigen.
Folge 7: KI macht Bildung maßgeschneidert
Michael Engel über die Zukunft des personalisierten Lernens und die Integration von KI in Bildungsangebote

Wie verändert KI die Zukunft des Lernens? Michael Engel, Head of Artificial Intelligence bei Cornelsen, teilt seine Visionen und Erkenntnisse. Im Gespräch mit Podcast-Host Dr. Florian Sochatzy erläutert Engel, wie KI das Lernen individualisieren und Bildungsmaterialien revolutionieren kann.
„Das Schulbuch bleibt wichtig. Was sich ändert, sind die neuen Möglichkeiten, es mit KI zu erweitern“, erklärt Engel. Er zeigt, wie KI bewährte Inhalte mit personalisierten Lernwegen ergänzen und so eine neue Ära des individualisierten Lernens einläuten kann.
Michael Engel beleuchtet, wie Cornelsen jahrzehntelange didaktische Expertise mit neuester KI-Technologie verbindet, um das Lernen auf eine völlig neues Level zu heben. Besonders spannend ist Engels Vision einer nahtlosen Integration von KI in Bildungsangebote:
„In mittlerer Zukunft werden wir über konkretes Feedback, persönliches Tutoring, Unterstützung und Entlastung bei der Korrektur sprechen.“
Er stellt Cornelsens Konzept einer Lernumgebung vor, in der KI ganz selbstverständlich unterstützt, ohne explizit als KI-Tool wahrgenommen zu werden. Darüber hinaus beleuchtet Engel, wie KI-Unterstützung es Lehrenden ermöglichen kann, sich auf ihre Kernaufgabe zu konzentrieren: inspirierenden und motivierenden Unterricht zu gestalten. Er diskutiert die Herausforderungen und Chancen bei der Integration von KI in den Bildungsalltag und gibt einen Ausblick in die Zukunft.
Michael Engel regt zu einem reflektierten und zukunftsorientierten Umgang mit KI in der Bildung an. Er zeigt auf, wie diese Technologie das Lernen und Lehren grundlegend verändern kann, ohne dabei die Bedeutung menschlicher Interaktion und didaktischer Expertise aus den Augen zu verlieren.
Folge 8: Muße oder Effizienz?
Hartmut Rosa über KI, Bildung und das gute Leben

Was macht KI mit unserem Verhältnis zur Welt und zur Zeit? Prof. Dr. Hartmut Rosa, einer der einflussreichsten Soziologen unserer Zeit, gibt tiefgehende Einblicke in die Auswirkungen der Digitalisierung auf Bildung und Gesellschaft. Im Gespräch mit Podcast-Host Dr. Florian Sochatzy entwickelt sich eine spannende Diskussion über die Zukunft des Lernens zwischen Effizienz und Muße. „Ein Hörer rief an und sagte, er habe Muße beim Rasenmähen. Er läuft mit dem Rasenmäher über sein großes Grundstück und kommt ins Nachdenken. Aber alle sagen: Kauf dir einen Roboter, dann sparst du Zeit. Und dann ist diese Mußezeit weg.“ Mit diesem eindrücklichen Beispiel illustriert Rosa das zentrale Dilemma unserer Zeit: Der Gewinn an Effizienz geht oft mit einem Verlust an echter Erfahrung einher.
Besonders kontrovers diskutieren Rosa und Sochatzy die Zukunft der Universität. Während Sochatzy für eine radikale digitale Transformation der Wissensvermittlung plädiert, betont Rosa die Bedeutung der Universität als sozialen Erfahrungsraum: „Studieren war eine Lebensform. Heute ist es eine Optimierungsaufgabe.“ Rosa reflektiert auch über die Veränderungen, die KI für Lehrende und Lernende mit sich bringt. Er warnt davor, Bildung auf reine Wissensvermittlung zu reduzieren: „Bildung ist nicht nur, dass ich danach etwas kann, was ich vorher nicht gekonnt habe, sondern es ist ein Prozess, in dem ich mich verwandle.“
„Die zentrale Frage ist nicht, ob KI uns schneller macht - sondern ob sie unser Leben besser macht“, resümiert Rosa. Er regt zu einem reflektierten Umgang mit KI in der Bildung an und zeigt auf, wie diese Technologie das Lernen und Lehren verändern kann, ohne dabei den menschlichen Aspekt aus den Augen zu verlieren.
Folge 9: KI als Chance für Bildungsgerechtigkeit
Sara Weber über Zukunftskompetenzen zwischen KI & Bildungsgerechtigkeit

Wie kann KI zu mehr Chancengleichheit im Bildungssystem beitragen? Sara Weber, Bestseller-Autorin von „Das kann doch jemand anderes machen!“, teilt überraschende Erkenntnisse. Im Gespräch mit Podcast-Host Benjamin Heinz zeigt Weber auf, wie KI ähnliche Effekte haben könnte wie die industrielle Revolution - sie könnte eine neue Mittelschicht schaffen.
„KI hilft vor allem Menschen mit weniger Erfahrung. Sie machen damit die schnellsten Fortschritte“, erklärt Weber. Sie gibt Einblicke in konkrete KI-Tools wie Notebook.lm und ResearchRabbit, die das Lernen und Arbeiten bereits jetzt demokratischer machen.
Weber diskutiert auch die Zukunft der Bildung bis 2050 und welche menschlichen Kompetenzen im KI-Zeitalter besonders wichtig werden. Dabei betont sie: „Deutschland ist immer noch ein Land, wo es ganz viel davon abhängt, was die Eltern gemacht haben. KI könnte das ändern.“
Im Staffelfinale der EDUCOUCH regt Weber zu einem reflektierten Umgang mit KI in der Bildung an. Sie zeigt auf, wie diese Technologie das Lernen und Lehren grundlegend verändern kann, ohne dabei die Bedeutung menschlicher Interaktion aus den Augen zu verlieren.
Folge 10: "Who Cares About AI?" - Wege zu einer besseren Bildung
Prof. Dr. Detmar Meurers über adaptive Lernsysteme, selbstbewusste Lehrkräfte und die Rolle der KI

Wie kann KI das Bildungssystem sinnvoll unterstützen? Prof. Dr. Detmar Meurers, Leiter des Bereichs "Sprache und KI in der Bildung" am Institut für Wissensmedien in Tübingen, räumt mit gängigen Mythen auf. Im Gespräch mit Podcast-Host Dr. Florian Sochatzy zeigt Meurers, warum es weniger um Technologie und mehr um echte pädagogische Herausforderungen geht.
"ChatGPT kann erst mal nichts und das wird nicht dadurch gelöst, dass man sagt: Ach, dann lernen halt zu prompten", stellt Meurers klar. Er gibt Einblicke in die Entwicklung adaptiver Lernsysteme und erklärt, warum KI-Übersetzer niemals den Fremdsprachenunterricht ersetzen können. Meurers betont: "Computer sollten Lehrkräfte nicht ersetzen, sondern befähigen."
Er plädiert für mehr Selbstbewusstsein bei Lehrkräften und einen kritischen Blick auf KI-Marketing im Bildungsbereich. Seine zentrale Botschaft "Who cares about AI?" ist dabei weniger Provokation als Aufruf, den Fokus wieder auf das Wesentliche zu lenken: die Lösung echter Bildungsherausforderungen mit kluger Unterstützung durch Technologie.
Folge 11: Von Deepfakes bis Dopamin
Franziska Hansel über KI, Kreativität & Bildung

Die AI Filmmaker und Ethics & Bias Officer bei Storybook Studios über kreative Grundkompetenzen im KI-Zeitalter
Wie revolutioniert KI den kreativen Schaffensprozess? Franziska Hansel, AI Filmmaker und Ethics & Bias Officer bei Storybook Studios in München, teilt ihre Expertise und Visionen. Im Gespräch mit Benjamin Heinz erklärt Hansel, wie sich die Rolle von Kreativen durch KI fundamental verändert.
"KI verändert nicht nur was wir tun, sondern wie wir denken", erläutert Hansel. Sie zeigt auf, warum kreative Grundkompetenzen im KI-Zeitalter wichtiger werden denn je und wie Bildung darauf reagieren sollte. Besonders wertvoll sind ihre praktischen Einblicke für Lehrkräfte zum Umgang mit dem Thema Deepfakes im Unterricht.
Hansel diskutiert auch die ethischen Dimensionen der KI-Revolution und gibt einen Ausblick, welche Skills in der Zukunft besonders wertvoll sein werden. Sie verbindet dabei technologisches Know-how mit einem tiefen Verständnis für kreative Prozesse und ethische Fragestellungen.
Eine inspirierende Folge, die sowohl Kreativschaffende als auch Lehrkräften mit konkreten Impulsen für den Umgang mit KI in Bildung und Beruf versorgt.
Folge 12: Von KI-Tutoren bis TikTok-Diplomatie
Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch über KI im Klassenzimmer und digitale Strategien

Wie kann Bildungspolitik den digitalen Wandel gestalten? Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch gibt Einblicke in ihre Vision für das Bildungssystem im KI-Zeitalter. Im Gespräch mit Host Dr. Florian Sochatzy diskutiert sie innovative Ansätze zur Integration von KI und Social Media in den Schulalltag.
"KI ist da. Dann sollten wir auch wirklich den Mehrwert und die Chance darin sehen", betont Günther-Wünsch. Sie erläutert, wie KI Lehrkräfte entlasten kann und warum digitale Basiskompetenzen heute unverzichtbar sind. Besonders spannend ist ihr Blick auf die Umgangsstrategien mit Social Media und TikTok an Schulen - statt Verbote plädiert sie für einen konstruktiven Dialog.
Die Bildungssenatorin gibt auch Einblicke in Berlins Ansätze zur Regulierung digitaler Medien im Bildungskontext und erklärt, welche Rolle eine Bildungs-ID für individualisierte Förderung spielen könnte. Sie verbindet dabei pragmatische Politik mit neuen Ideen für die Zukunft des Lernens.
Eine aufschlussreiche Folge, die zeigt, wie Bildungspolitik den schmalen Grat zwischen technologischer Innovation und Didaktik navigieren kann.
Folge 13: Neue Schulstudien 2025: Schüler*innen als KI-Pioniere, Schulleitungen als Rebellen
Host Benjamin Heinz diskutiert mit Matthias Graf von Kielmansegg und Prof. Dr. Klaus Hurrelmann die Vodafone Stiftung-Jugendstudie und die Cornelsen-Schulleitungsstudie

Wie nutzen Schüler*innen KI und welche Herausforderungen haben Schulleitungen? Benjamin Heinz diskutiert mit zwei renommierten Experten zwei aktuelle Studien, die Einblicke in den Wandel des deutschen Bildungssystems geben. Im Gespräch erläutern Matthias Graf von Kielmansegg und Prof. Dr. Klaus Hurrelmann Erkenntnisse aus den beiden Bildungsstudien.
"Wir haben eine Umkehr der Innovationsrichtung", erklärt Graf von Kielmansegg. "Die Schülerinnen und Schüler gehen voran und der Rest muss sehen, dass er mitkommt." Die Vodafone-Jugendstudie mit über 7.000 SchülerInnen aus sieben europäischen Ländern zeigt: 42 % der deutschen Jugendlichen nutzen regelmäßig ChatGPT, aber nur 44 % fühlen sich von ihren Lehrkräften gut unterstützt.
Die Cornelsen-Schulleitungsstudie bestätigt diesen Trend aus anderer Perspektive. "Schulleitungen merken, dass dieses bürokratische, noch aus der preußischen Ordnung stammende hierarchische Konzept von Schulmanagement im digitalen Zeitalter nicht mehr funktioniert", betont Hurrelmann. Etwa 60 % der befragten Schulleitungen sind bereit, an die Grenzen der rechtlichen Vorgaben zu gehen, um Innovationen zu ermöglichen.
Die Experten besprechen, wie KI die traditionellen Rollen von Lehrenden und Lernenden verschiebt und welches Potenzial in intelligenten tutoriellen Systemen für individualisiertes Lernen steckt. Besonders spannend: Beide Studien warnen vor einer drohenden digitalen Kluft durch KI - bieten aber auch Lösungsansätze für mehr Bildungsgerechtigkeit.
Eine hochaktuelle Folge, die zeigt: Schüler*innen sind als KI-Pionier*innen unterwegs und Schulleitungen zunehmend als mutige Rebellen im Kampf gegen Eine hochaktuelle Folge, die zeigt: Schüler*innen sind als KI-Pionier*innen unterwegs und Schulleitungen zunehmend als mutige Rebellen im Kampf gegen althergebrachte Strukturen. Strukturen.
Folge 14: Der rote Faden des Lernens
Christine Hauck über Bildungswandel, die Zukunft des Schulbuchs und wie künstliche Intelligenz unser Lehren und Lernen verändert

Wie verändert KI das Lernen und die Rolle von Bildungsmedien? Christine Hauck, Geschäftsführerin bei Cornelsen, gibt Einblicke in die Transformation der Bildungslandschaft. Im Gespräch mit Podcast-Host Dr. Florian Sochatzy diskutiert sie die Balance zwischen digitaler Innovation und grundlegenden Bedürfnissen im Bildungssystem.
"Die KI kann adaptiv genau den Lernstand zur Verfügung stellen, auf dem du gerade bist. Sie kann auf deine Hobbys eingehen und dir eine Lektion zu deiner Lieblingsmusikerin machen," erklärt Hauck. Sie skizziert, wie KI-Tutoren individualisiertes Lernen ermöglichen können, betont aber gleichzeitig: "Das Lernen wird immer noch ein sozialer Prozess sein."
Besonders erhellend ist Haucks Perspektive auf die Kontraste im heutigen Bildungssystem: "Wir reden über KI, aber wir haben auf der anderen Seite die Heterogenität, dass Kinder in die Schule kommen und sich die Schuhe nicht mehr binden können." Sie beleuchtet, wie Schulen und Bildungsverlage auf diese doppelte Herausforderung reagieren müssen.
Hauck gibt auch Einblicke in die aktuelle Cornelsen Schulleitungsstudie, die zeigt: Schulleitungen sehen sich zunehmend als "visionäre Reformer" und "Rebellen" im Bildungssystem. "Sie fragen manchmal nicht erst, sondern machen. Und entschuldigen sich hinterher," fasst sie zusammen.
Mit Blick auf die Zukunft prognostiziert Hauck: "KI wird zunehmend eine Commodity in verschiedenen Arbeitsabläufen sein. Wir werden gar nicht immer sagen, das ist KI, sondern das wird einfach selbstverständlich sein." Sie gibt Einblicke, wie der Bildungsverlag selbst diesen Wandel gestaltet und warum Diversität und Inklusion in Bildungsmedien dabei eine zentrale Rolle spielen.
Eine aufschlussreiche Folge, die zeigt, wie der "rote Faden" des Lernens im Spannungsfeld zwischen grundlegenden Alltagskompetenzen und KI-gestützten Bildungsmedien neu geknüpft wird.
Folge 15: Fremdsprachen vor dem größten KI-Umbruch
Prof. Dr. Katharina Scheiter über den unterschiedlichen Einfluss von KI auf Schulfächer

Wie stark verändert KI verschiedene Unterrichtsfächer? Prof. Dr. Katharina Scheiter, Professorin für Digitale Bildung an der Universität Potsdam, teilt ihre überraschenden Einschätzungen. Im Gespräch mit Podcast-Host Benjamin Heinz bewertet sie den KI-Einfluss auf einer Skala von 1-10 und prognostiziert für Fremdsprachen mit 8/10 den größten Umbruch.
"Übersetzungstools sind inzwischen so ausgereift, dass wir in ganz andere Szenarien gehen können. Ich kann mit einer KI in Französisch, Spanisch oder sonst was mich unterhalten, kann Sprachkompetenzen trainieren", erklärt Scheiter. Sie diskutiert, wie sich dadurch das Fremdsprachenlernen grundlegend verändern wird, während Mathematik (7/10) und Kunst (5/10) weniger stark betroffen sind.
Besonders aufschlussreich ist Scheiters Beobachtung zum Nutzungsverhalten: "Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler setzen KI häufig sparsam und gezielt ein, während schwächere Schüler die Antworten eins zu eins übernehmen" - ein Bildungsgerechtigkeitsparadox, das bestehende Ungleichheiten verstärken könnte.
Die Expertin räumt auch mit einem hartnäckigen Mythos auf: "Digital Natives existieren nicht. Auch wenn Kinder und Jugendliche bei der Nutzung dieser Tools fitter wirken als Erwachsene, heißt das noch lange nicht, dass sie sie didaktisch sinnvoll nutzen können." Sie plädiert für eine angeleitete KI-Nutzung und differenzierte Betrachtung besonders in der Grundschule.
Scheiter gibt zudem Einblicke in ihre eigene KI-Nutzung: "Ich verwende KI, um meine komplexen wissenschaftlichen Texte zu vereinfachen" und zeigt, wie KI Lehrkräfte bei Routineaufgaben entlasten kann, ohne den pädagogischen Kern des Unterrichts zu ersetzen.
Eine aufschlussreiche Folge, die zeigt, wie unterschiedlich KI verschiedene Fachbereiche transformieren wird und welche didaktischen Konsequenzen daraus folgen.
